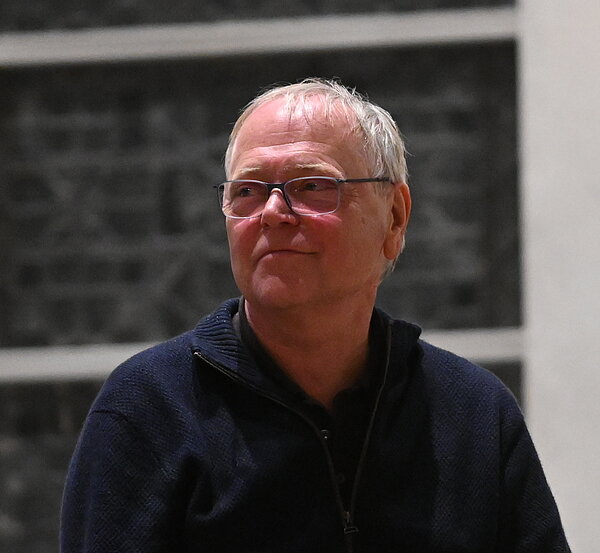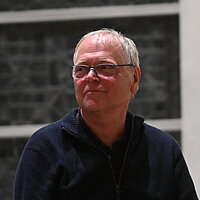Erstmals hat das Projekt "Zeitzeugen" - in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Taunus - die Perspektive von Verfolgten und Tatbeteiligung zusammen gebracht, dies aus gutem und am Ende der Veranstaltung auch ersichtlichen Grund. Auch wenn Moderator Gottfried Kößler darauf verwies, dass es sich um keine Gedenkveranstaltung handle, so stand dieser Abend trotzdem im Schatten des bevorstehenden Gedenkens an den 86. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9./10.11.1939.
Eine öffentliche Begegnung
Marcel Neeb, Schulleiter der St.-Angela-Schule Königstein, begrüßte die über 30 anwesenden Personen aller Altersstufen in der Aula und verwies auf die historische Bedeutung dieses Ortes. Nach 1940 waren die Schwestern des Ursulinenordens von Nationalsozialisten aus ihrem Haus vertrieben worden und die heutige Aula, die damals Kapelle war, wurde mit Hakenkreuzflaggen bestückt und eine Hitlerbüste auf den Altartisch gestellt. Neeb zitierte auch aus einem Abschiedsbrief der Schwestern an die damaligen Schülerinnen, dass sie "die Wahrheit suchen an jedem Ort" und "wie Kerzen leuchten" sollten, wo sie sind. Ein Auftrag auch für die heutige Zeit.
Birgit Wehner führte dann in den Abend ein als Mitveranstalterin der Katholischen Erwachsenenbildung Taunus. Sie verwies auf die anschließend folgenden beiden konträren Familiengeschichten.
Gottfried Kößler, Gedenkstättenpädagoge und bis 2019 stellvertretender Direktor des Fritz Bauer Institus, stellte Judy Rosenthal und Frank Paulun vor. Beide hatten sich bei einem partizipitativen Projekt zu NS-Spurensiche im Historischen Museum Frankfurt kennen gelernt.
"Die Familie war jüdisch..."
Judy Rostenthal stellte dann in einem 17minütigen Film ihre Familiengeschichte vor. Ein Stammbaum mit seinen verschiedenen Ästen und Blättern, die sich nach und nach mit Gesichtern füllten, enthüllte auch nach und nach die Geschichten hinter diesen Gesichtern und Personen. Wichtig war Judy Rosenthal zu betonen, dass es nicht zuvorderst eine "Opfergeschichte" sei, die sie erzähle.
Sie selbst ist in Chicago geboren und lebt seit 45 Jahren in Deutschland. Bewegend war der Moment, als sie von einem Gedichtband erzählte, den ihre Schwester Sarah herausgegeben habe mit dem Titel "Lizard" und der Tante Lisl gewidmet ist, die in der Shoah ermordet wurde.
"unbedenklich"

Frank Paulun begann sich erst nach seiner Verrentung mit seiner Familiengeschichte zu beschäftigen. Die Recherche begann mit einem Schuhkarton, in dem Dokumente und Fotos aufbewahrt worden waren. Nach und nach erschloss sich, dass sein Großvater in einem Polizeibataillon in Osteuropa bei Massenerschießungen beteiligt war. Im Rahmen der Entnazifizierung durch die britischen Behörden wurde er als "unbedenklich" eingestuft - er hatte allerdings nachweislich falsche Angaben gemacht (wie es nach 1945 bei vielen Meldebögen üblich war). Der Vater von Paulun war als 17jähriger der SS beigetreten und wurde nach 1945 ebenfalls Polizist.
Unsere Erinnerung
Die Frage, die sich nach dem von Gottfried Kößler moderierten Gespräch stellte, war auch, wie wir mit unseren Erinnerungen, unserer Familiengeschichte heute umgehen. Welche Verantwortung daraus erwachsen kann.
Marc Fachinger vom Projekt "Zeitzeugen" zitierte hier die Zeitzeugin Henriette Kretz, die einen Monat zuvor bei einem öffentlichen (im youtube Kanal veröffentlichten) Gespräch anlässlich des 3. Oktober mit 4 weiteren Zeitzeug:innen gefragt hatte: "Was ist IHRE Erinnerung?" Ganz im Sinne von Judy Rosenthal nicht immer nach den Erinnerungen der "Opfer" zu fragen - also der mutigen Zeitzeug:innen, die als Holocaust-Überlebenden sich immer wieder ihrer schmerzhaften und grauenvollen Vergangenheit stellten - sondern in die Erinnerung der "Täter" zu schauen. Hier wiederholte Fachinger, was er schon an einigen Stellen gesagt hat, dass er überzeugt ist, dass die deutsche NS-Vergangenheit noch lange nicht "aufgearbeitet" sei.
Ein Abend also, der keinen Abschluss darstellte.
Anregungen zu Recherchen eigener NS-Familiengeschichte
Frank Paulun verwies auf ein einführendes Video "Familienbiografische Recherche"
Eckdaten wie vollständiger Name, Geburts- und Sterbedatum sei wichtig. Für amtliche Dokumente könne bei örtlichen Rathäusern, Standesämtern oder Stadtarchiven angefragt werden, auch bei Vereinen, in denen die Person aktiv war.
Eine Anleitung zur historischen Projektarbeit der Körber-Stiftung gibt sehr gute Anregungen
Digital ist eine erste Anlaufstelle das Bundesarchiv
Für Hessen gilt als erste Anlaufstelle das digitale System des Hessischen Hauptstaatsarchivs
https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/simpleSearch.action
Hier kann ohne Anmeldung recherchiert werden und vieles auch digitalisiert heruntergeladen werden. Über eine Registrierung können Akten an den jeweiligen Standorten, wie dem Hauptsitz in Wiesbaden, vor Ort eingesehen und selbst digitalisiert werden. Gegen eine Gebühr von € 0,50 pro Seite wird dieser Dienst auch von Archivmitarbeiter:innen übernommen.
Weitere Anfragen können auch über das Projekt "Zeitzeugen" gestellt werden.
Online-Unterrichtsmodul „Die Familie war jüdisch …“ – Biografisches Lernen am Beispiel einer deutsch-jüdischen Familie
Das vom Fritz Bauer Institut entwickelte Online-Unterrichtsmodul „Die Familie war jüdisch …“ – Biografisches Lernen am Beispiel einer deutsch-jüdischen Familie setzt sich am Beispiel des autobiografisch-dokumentarischen Kurzfilms DIE FAMILIE WAR JÜDISCH … von Judy Rosenthal mit der Frage des Umgangs mit der eigenen Familiengeschichte und der gesellschaftlichen Erinnerung an die Shoah auseinander. Der Film wirft vielfältige Fragen zur Geschichte und Situation der Familienangehörigen sowohl im Exil als auch im nationalsozialistischen Deutschland auf. Diese können im Rahmen des Unterrichts mithilfe der im Modul enthaltenen Materialien – Kurzbiografien, Informations- und Sachtexten, Bilder und Dokumente sowie ein Glossar – beantwortet und vertieft werden.
Fach / Schulform / Klassenstufe
Geschichte, Politik und Wirtschaft, Ethik/Religion; Gymnasium, Real- und Hauptschule; Klassenstufe 9/10 sowie Sekundarstufe II
Das Unterrichtsmodul geht auf die aktuellen Herausforderungen der Lehrkräfte ein, unterschiedliche Lernniveaus und die Diversität der Lernenden zu berücksichtigen. Besonderes Augenmerk wurde darauf gerichtet, ein Unterrichtsmaterial für Lernende zu entwickeln, die möglicherweise weder Vorwissen noch einen familienbiografischen Bezug zum Nationalsozialismus haben.
Zeitrahmen: 4 Unterrichtsstunden
Autorin:Ann-Kathrin Rahlwes im Auftrag des Fritz Bauer Instituts Frankfurt am Main




 Bildergalerie
Bildergalerie